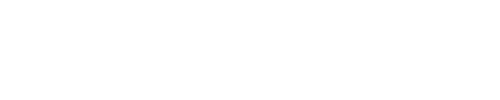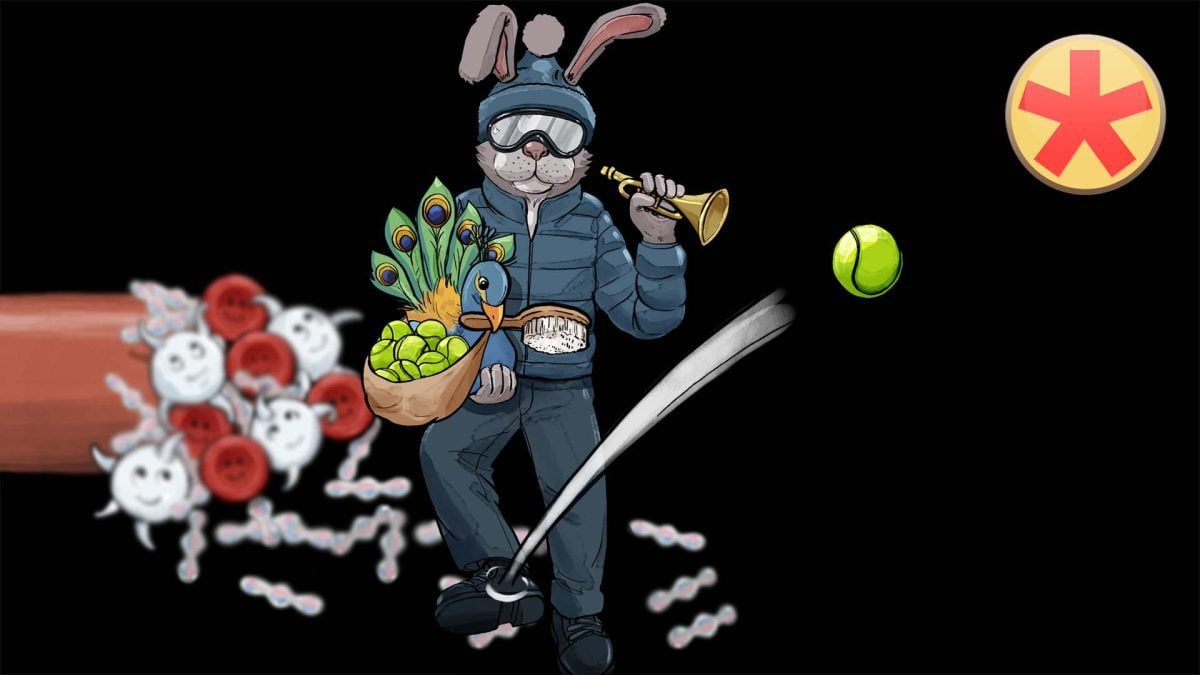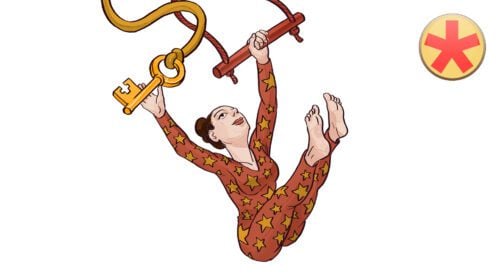Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
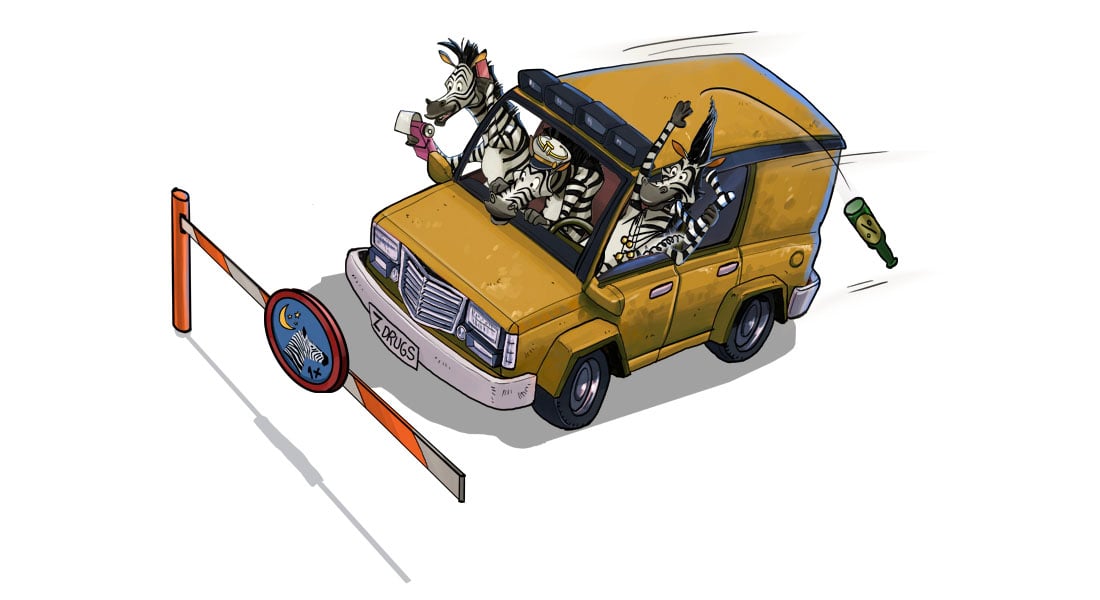
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Sekundäre Hämostase
Basiswissen
-
Allgemein
Stabilisierung des lockeren weißen Thrombus
Bündel aus weißen Thrombozyten-Wichteln, weißer “Trompeten-Bus”
Die sekundäre Hämostase wird auch als Blutgerinnung bezeichnet. Ziel der sekundären Hämostase ist die Stabilisierung des lockeren weißen Thrombus aus der primären Hämostase.
-
Allgemein
Stabiler Wundverschluss – roter Thrombus
Blutleck nach Rohrbruch wird verschlossen – “roter Trompeten-Bus”
Durch ein Netzwerk aus Fibrinsträngen kommt es zu einem stabilen Wundverschluss, in dem sich neben den Thrombozyten auch Erythrozyten verfangen – diesen Thrombus bezeichnet man daher als roter Thrombus ([[Abb. 2]]).
-
Allgemein
Aktivierte Gerinnungsfaktoren (GF) = Proteasen → Aktivierung nachfolgenden GF
Hase aktiviert von gefräßigem Tennisball
Die meisten GF kommen als inaktive Vorläuferproteine im Blutplasma vor (→ plasmatische Gerinnung). In ihrer aktivierten Form sind GF selbst Proteasen (Enzyme) und aktivieren den nachfolgenden GF durch proteolytische Spaltung. Es kommt so zu einer Kettenreaktion aus Aktivierungen, die in der Bildung von Fibrinmonomeren endet.
-
Allgemein
Stufenartige GF-Aktivierung: Sicherheitsschalter
Helferlein aktivieren sich gegenseitig: chillt auf Traktor im Blutfluss
Die Gerinnung darf im Körper nicht unreguliert beginnen, deshalb kann man diese Kaskade als “Sicherheitsschalter” verstehen. So gibt es auch Kontrolleure der Gerinnung (wie Protein C und S), um den Körper vor einer übermäßigen Fibrinbildung zu schützen (s. Hemmung der Blutgerinnung und Fibrinolyse).
-
Allgemein
GF: gebunden an Zelloberflächen
Schwimm-Traktor gebunden an Pool-Wand
Die Faktoren befinden sich gebunden an Zellmembranen und reagieren nicht frei im Plasma miteinander. Erst der Faktor II (Thrombin) ist stabil genug, um andere Faktoren (als Funke) zu aktivieren, indem er sich von der Bindung an die Zelloberfläche löst.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.