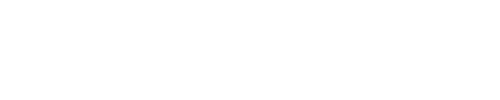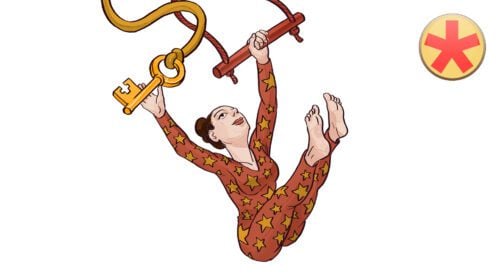Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
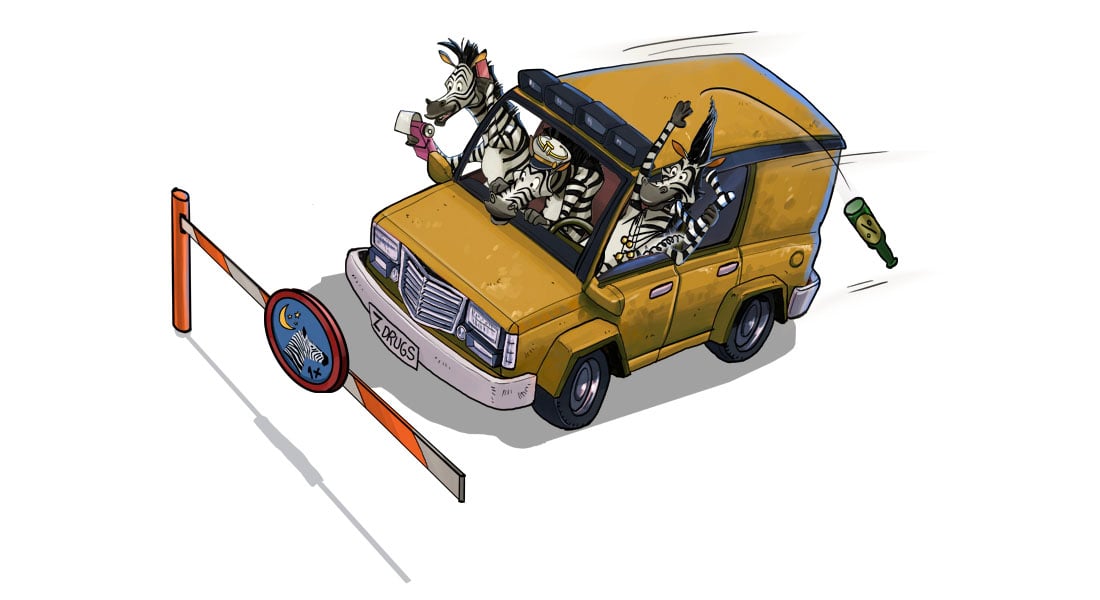
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Mendel’sche Regeln
Basiswissen
-
Allgemeines
“Vater der Genetik”: Mendel
Erbsen des Gen-Engels Mendel
Als Vater der Genetik bezeichnet man den Mönch Gregor Mendel, der Kreuzungsversuche mit Erbsen gemacht und die Weitergabe ihrer Eigenschaften untersucht hat.
-
Allgemeines
Vererbung: Weitergabe von Merkmalen & Genen
Erbsensünde: Aussehen der Kinder
Im engeren Sinn bezeichnet die Vererbung in der Biologie die Weitergabe von Merkmalen und Genen von einer Generation zur nächsten.
-
Allgemeines
Vererbungslehre: Wie? Wie wahrscheinlich?
Gen-Engel kalkuliert Wahrscheinlichkeiten
Die Vererbungslehre beschäftigt sich damit, wie und mit welcher Wahrscheinlichkeit Gene und Merkmale weitergegeben werden.
-
Grundbegriffe
Phänotyp: “Merkmale” → Erscheinungsbild & Eigenschaften
Feentyp: “mit Muttermalen“ → verspricht Schönheit & Charakter
Die Summe aller beobachtbaren Merkmale eines Individuums wird als Phänotyp bezeichnet. Merkmale umfassen das äußere Erscheinungsbild (Haarfarbe) und die Eigenschaften (Charakter) eines Individuums.
-
Grundbegriffe
Genotyp: gesamtes Erbbild / Genvarianten
Gen-Typ-Schlange verspricht Wissen
Das gesamte Erbgut eines Individuums – das Erbbild also – wurde ursprünglich Genotyp genannt. Wenn man heutzutage aber von Genotypen spricht, meint man meist nicht das gesamte Erbgut, sondern die Variante eines einzelnen Gens (oder Genabschnitts), s. Extrawissen.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.