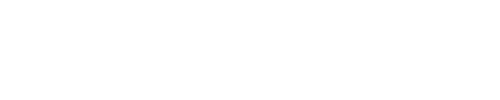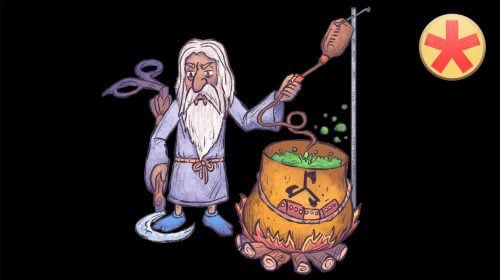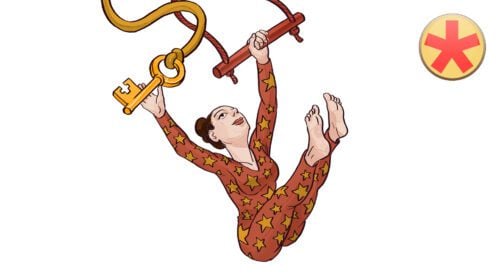Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
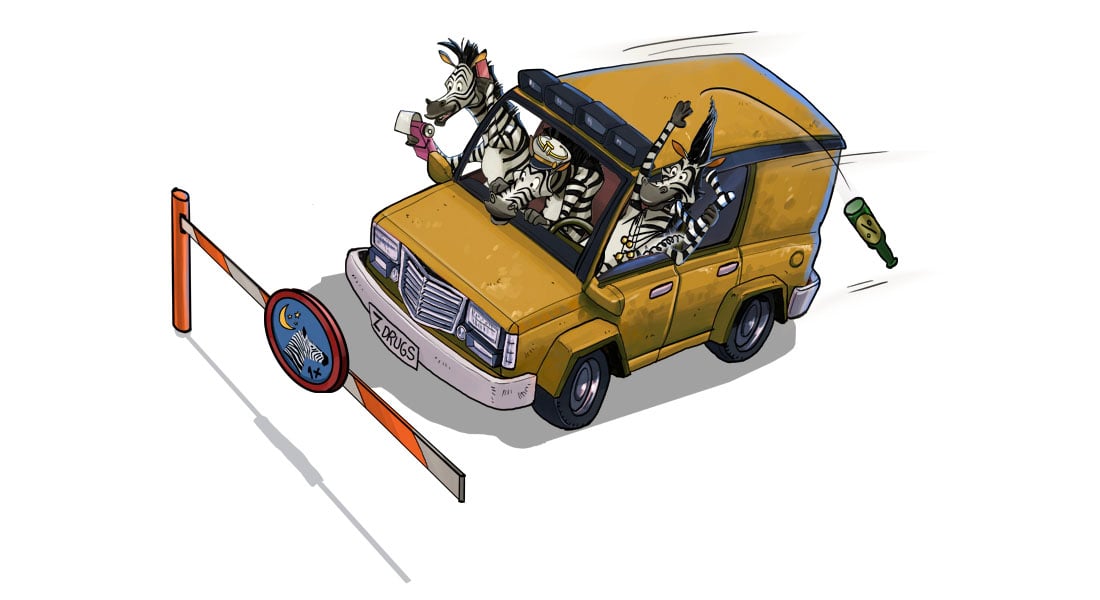
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Cholelithiasis 1: Cholezystolithiasis
Basiswissen
-
Allgemein
Chole-lithiasis: Gallensteine
Hinkelsteine der Gallier
Die Cholelithiasis (altgr. „chole“ – Galle, „lithos“ – Stein) bezeichnet das Vorhandensein von Gallensteinen, unabhängig von deren Lokalisation (d.h. Gallenblase und/oder Gallenwege).
-
Allgemein
Chole-zysto-lithiasis: Gallen-blasen-steine
Hinkelsteine in der Steinwerkstatt
Die Gallenblase ist der Hauptort der Steinbildung. Daher wird der allgemeinere Begriff Cholelithiasis oft mit der Cholezystolithiasis gleichgesetzt. Siehe [[Abb. 2]]
-
Allgemein
Chole-docho-lithiasis: Gallensteine im Hauptgallengang (Ductus choledochus)
Hinkelstein an der Haupt-Via Gallica
-
Allgemein
Epidemiologie: Frauen doppelt so häufig betroffen
Hinkelsteinwerkstatt gehört einer Gallierin
Gallenblasensteine sind sehr häufig, die Prävalenz liegt bei ca. 20% in Deutschland.
-
Allgemein
Gallen-blasen-steine: meist asymptomatisch
Glücklicher (asymptomatischer) Hinkelstein
In ca. 75% der Fälle verursachen Gallenblasensteine keine Beschwerden.
...
Expertenwissen
-
Ätiologie > Steintypen
Bilirubinsteine: aus indirektem (unkonjugiertem) Bili
Rubin-Hinkelsteine: tragen indische Turbane
-
Ätiologie > Steintypen
Schwarze Bilirubinsteine
Schwarzer Rubin-Hinkelstein
Schwarze Pigmentsteine bestehen aus Calcium-Bilirubinat, das entsteht, wenn unkonjugiertes Bilirubin Calcium bindet. Sie sind sehr hart und strahlen-undurchlässig, sprich im Röntgen sichtbar.
-
Ätiologie > Steintypen
Schwarze Bilirubinsteine entstehen bei chronischer Hämolyse
Rote Ery-Blasen zerplatzen am Stein
Bei einer Hämolyse fällt viel unkonjugiertes Bilirubin an. Das wird in die Galle abgegeben und führt zur Übersättigung.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.