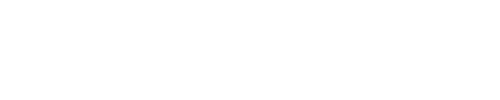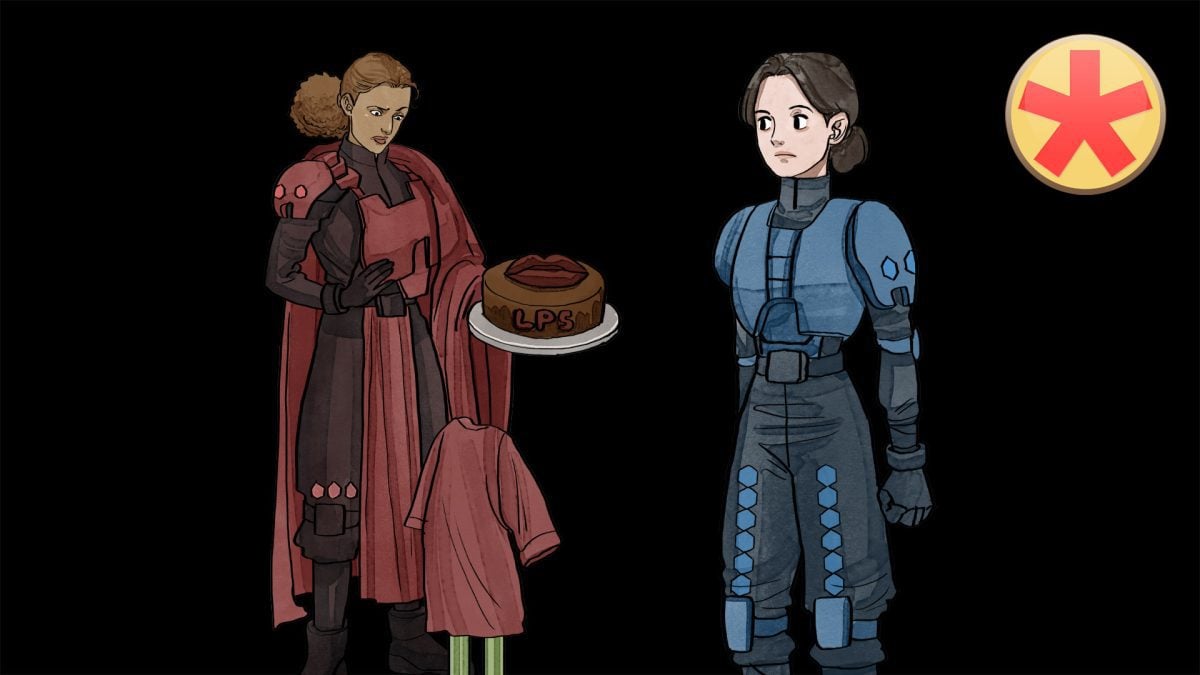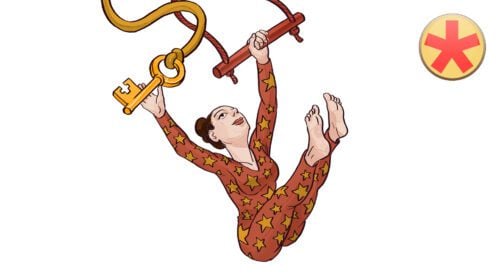Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
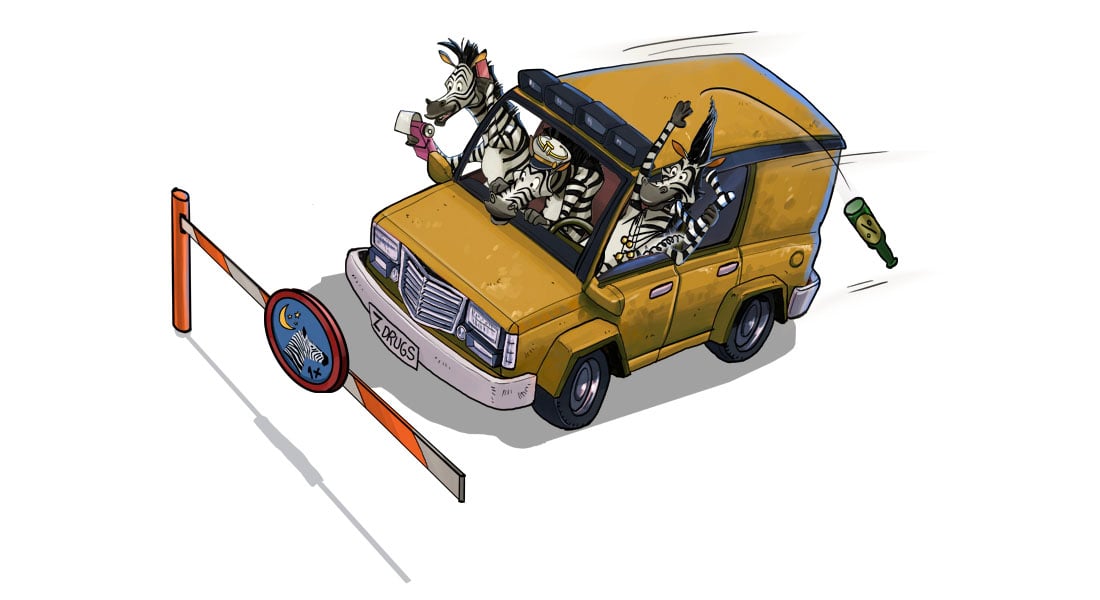
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:
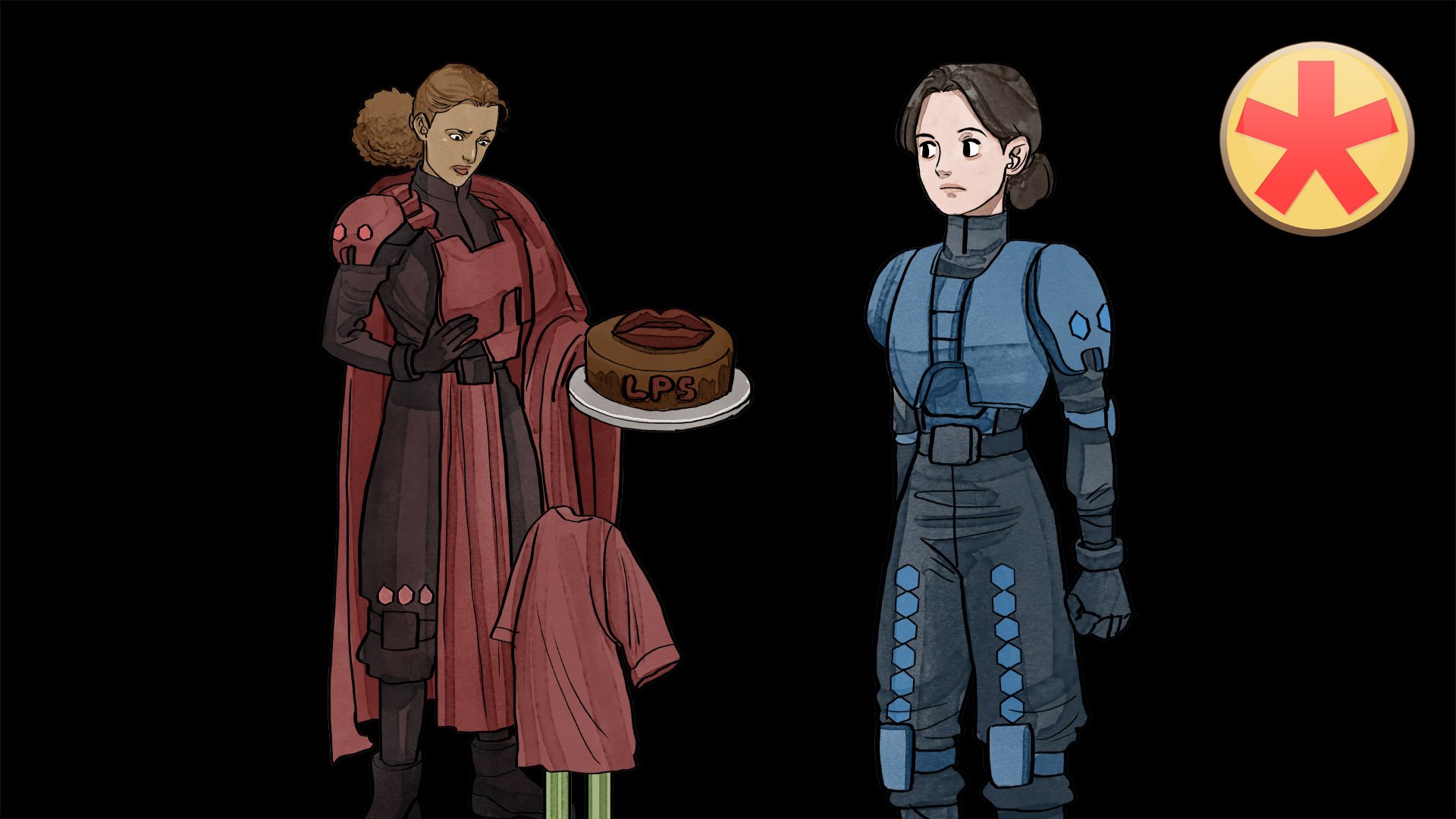
Bakterien 1: Grundlagen
Basiswissen
-
Allgemeines
Bakterien vermehren sich selbstständig
Wesen teilen und vermehren sich
Bakterien sind kleine, einzellige Mikroorganismen. Der Durchmesser der meisten Bakterien liegt zwischen 0,2 und 2 μm – also nur mit Mikroskop zu erkennen. Sie zählen zu den Lebewesen, da sie u.a. einen eigenen Metabolismus haben und sich selbständig vermehren können.
-
Allgemeines
Residente Flora: physiologische Besiedelung mit Bakterien
Resident mit Blume: wilde Bewohner
Ab der Geburt besiedeln Bakterien (auch Kommensalen) Haut und Schleimhäute und bilden die “Normalflora”. Sie rufen meist keine klinischen Symptome hervor, sondern haben eine Schutzfunktion/ “Platzhalterfunktion”: sie hindern pathogene Keime daran, sich zu vermehren, evtl. in den Körper einzudringen und Krankheiten hervorzurufen.
-
Allgemeines
Transiente Flora: vorübergehende Besiedlung
Transport-Flotte: macht Zwischenhalt
Neben der residenten Flora gibt es Bakterien, die unsere Haut und Schleimhäute nur vorübergehend besiedeln – die transiente Flora.
-
Allgemeines
Immunsuppression: transiente Flora langfristig → Erkrankung
Geschwächter Wilder mit AIDS-Flagge → von Söldner beäugt
Unter veränderten Bedingungen wie Veränderungen der residenten Flora oder einer geschwächten Immunabwehr (bspw. AIDS oder Immunsuppression durch Medikamente), kann die transiente Flora sich langfristig ansiedeln und als residente Flora u.U. Erkrankungen auslösen.
-
Allgemeines
Fakultativ pathogen: “u.U. krankheitserregend”
Eindringling der “Pathologischen Fakultät”: überlegt anzugreifen
Fakultativ pathogene Bakterien lösen nicht zwingend eine Erkrankung aus.
...
Expertenwissen
-
Charakteristika der Bakterien > Prokaryoten
Plasmide versch. Größe zufällig auf Tochterzellen verteilt
Ringe versch. Größe zufällig auf zwei Stapel verteilt
Die Anzahl und Größe der Plasmide in einem Bakterium ist sehr variabel. Sie replizieren sich unabhängig vom Bakterienchromosom und werden bei der Zellteilung zufällig mit dem Zytoplasma auf die Tochterzellen verteilt.
-
Charakteristika der Bakterien > Prokaryoten
100 bis 1000-fache Kopien kleinerer Plasmide
Hund & Tau
Von den größeren Plasmiden liegen meist nur wenige Kopien pro Bakterium vor, wobei von den kleineren Plasmiden 100 bis (in wenigen Fällen) 1000-fache Kopien vorhanden sind.
-
Charakteristika der Bakterien > Zellwand & -membran
Zellwandsynthese-Hemmer: ß-Laktam-Antibiotika binden Transpeptidasen
Mauer-Konstrukteur erledigt: BL-Milchflasche bei † Transport-Hasen
Die Transpeptidasen bilden Komplexe mit den ß-Laktam-Antibiotika aus (z.B. Penicillin). Sie stehen dann nicht mehr für die Ausbildung der transpeptidischen Bindungen zwischen NAM- und NAG-Molekülen zur Verfügung und die Zellwandstruktur ist beeinträchtigt – es kommt zur Lyse des Bakteriums durch einströmende Flüssigkeit.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.