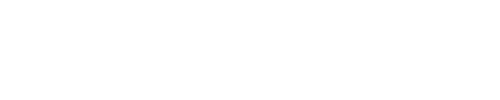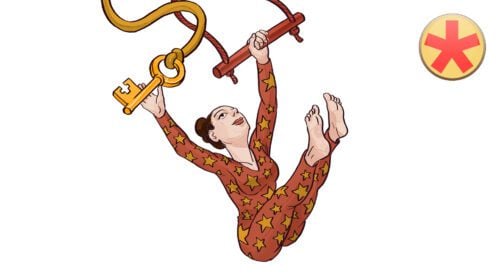Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
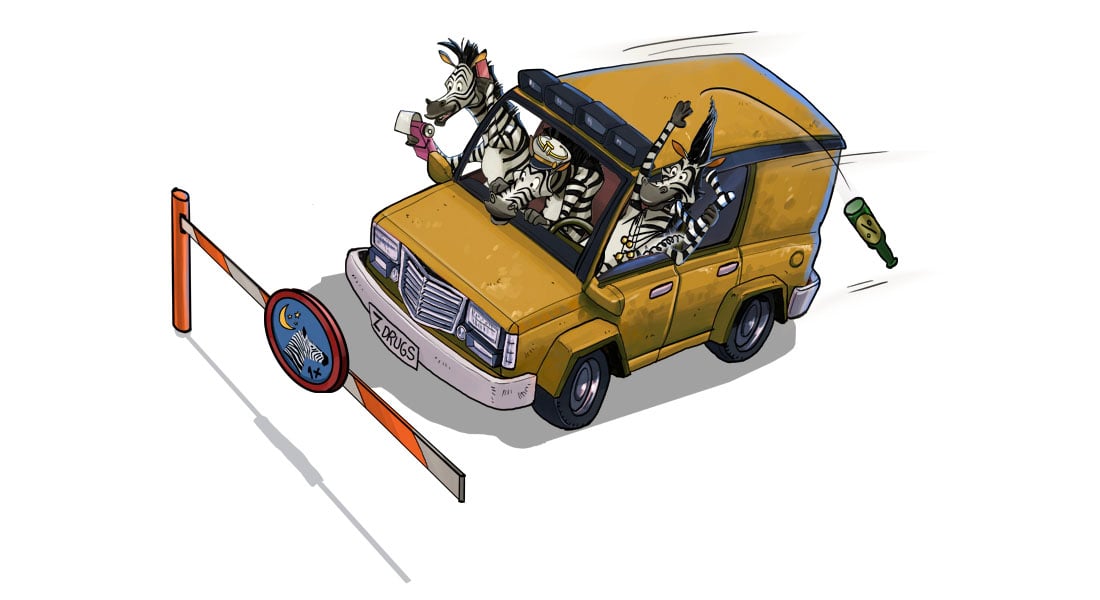
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Astrozytome
Basiswissen
-
Allgemein
Astrozytome entstehen aus den Astrozyten
Astronomen unter Sternen – Mutanten aus Gehirnplanet Cerebrum
Astrozyten sind sternförmige Zellen des Gehirngewebes. Entarten die Astrozyten, kommt es zu Astrozytomen (Stern-Mutanten). Es sind also primäre Hirntumore.
-
Allgemein
Astrozytome haben eine gute (heilbar) bis sehr schlechte Prognose mit kurzer Überlebenszeit
Astronomen gelangen zu guten bis sehr schlechten Prophezeiungen – Horizont verdunkelt sich von links nach rechts
Astrozytome können heilbar sein, wie etwa das pilozytische Astrozytom. Höhergradige Astrozytome haben jedoch auch unter optimaler Therapie eine sehr kurze mittlere Überlebenszeit.
-
Allgemein
Ionisierende Strahlung: einziger gesicherter Risikofaktor
Kosmische Hintergrundstrahlung führt zu Monstern
-
Allgemein
Tumorprädispositionssyndrome sind mit Astrozytomen assoziiert: Li-Fraumeni-Syndrom
Litschi-Pfau begleitet Monster
Tumorprädispositionssyndrome führen durch genetische Variationen zum gehäuften Auftreten von Tumoren, so etwa das Li-Fraumeni-Syndrom.
-
Klassifikation
WHO-Klassifikation: vier Schweregrade
WHO-Plateau und Gebirgsgrat mit vier unterschiedlichen Stufen
Grob spricht man bei Grad 1 und 2 von niedriggradigen Gliomen (niedrigeres Plateau). Grad 3 und 4 bilden die höhergradigen Gliome (Gebirgsgrat).
...
Expertenwissen
-
Allgemein
Optikusgliome: Assoziiation mit Neurofibromatose Typ 1
Optiker-Glibber-Brille von Neuro-Vieh
Das Optikusgliom, ein pilozytisches Astrozytom des Nervus opticus, kommt gehäuft bei zugrundeliegender NF1 vor.
-
Klassifikation
IDH-Mutation: Methylierung von CpG-Inseln führt zur Inhibierung der Genexpression
Idee-Mutant umwickelt Zeitung/Guano-Inseln mit Tüll, Mutanten wachsen dadurch langsamer
Die Veränderung der IDH führt zur Hypermethylierung von CpG-Inseln in Promotorregionen der Tumorzellen. Das sind kurze Sequenzen, die reich an Cytosin und Guanin sind (Zeitung und Guano, ja genau, die Vogelscheiße). Diese Veränderungen sind mit langsamerem Tumorwachstum und besserer Prognose assoziiert.
-
Klassifikation > Grad 1: pilozytisches Astrozytom
Histologisch “Haar-ähnliches Aussehen” / makroskopisch zystische Anteile
Struwwelhaare des Kindes / Kaugummiblase
Pilos vom griech.: Haar beschreibt den mikroskopisch faserartigen (haar-ähnlichen) Aufbau. Histobild: [[Abb. 2]]. Makroskopisch finden sich in über 60% flüssigkeitsgefüllte Zysten mit einem hellen wandständigen Tumorknoten.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.