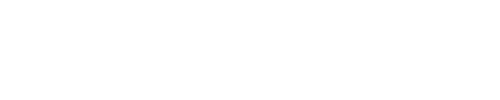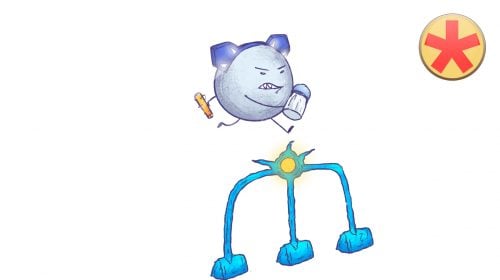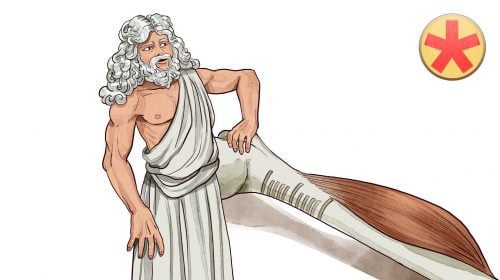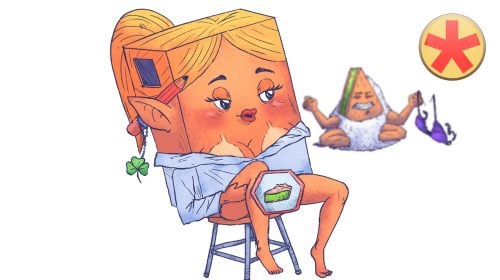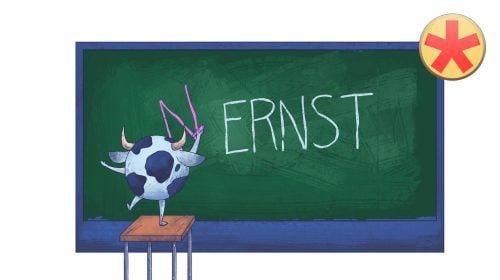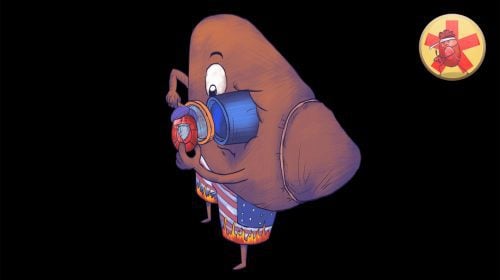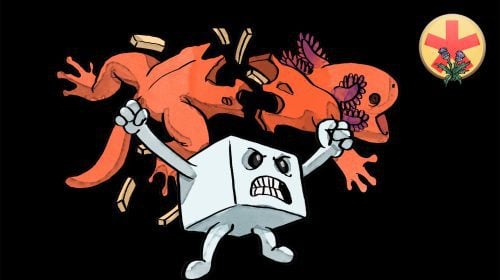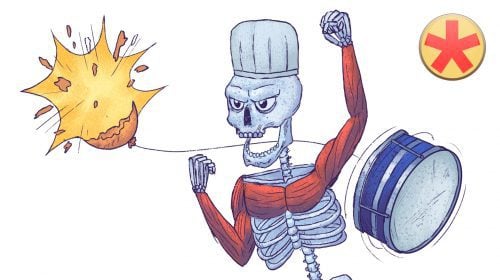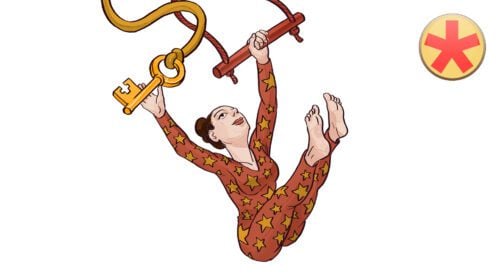Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
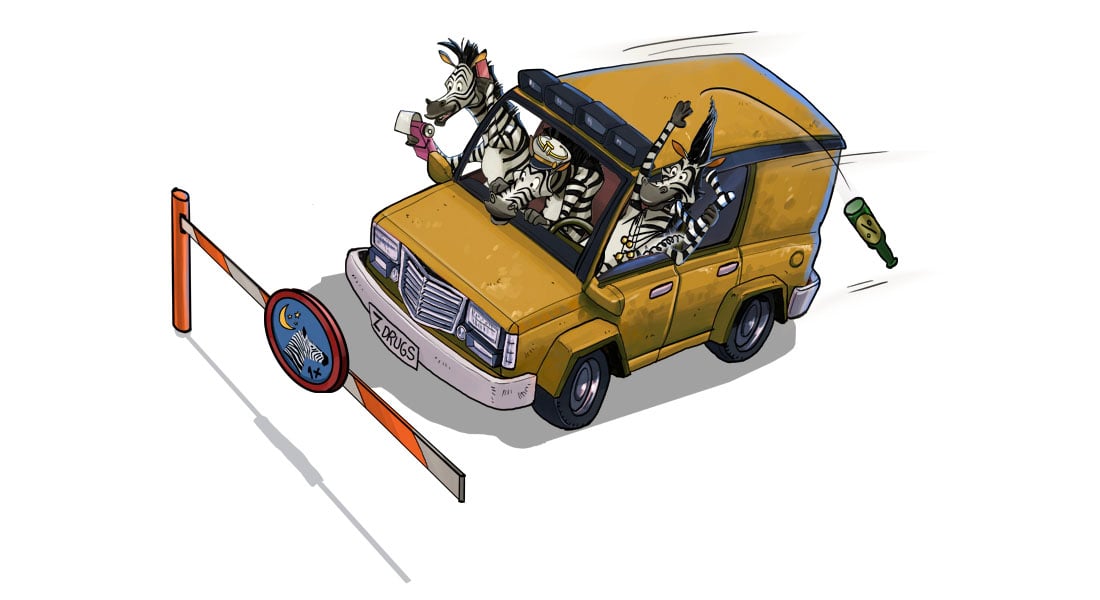
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:
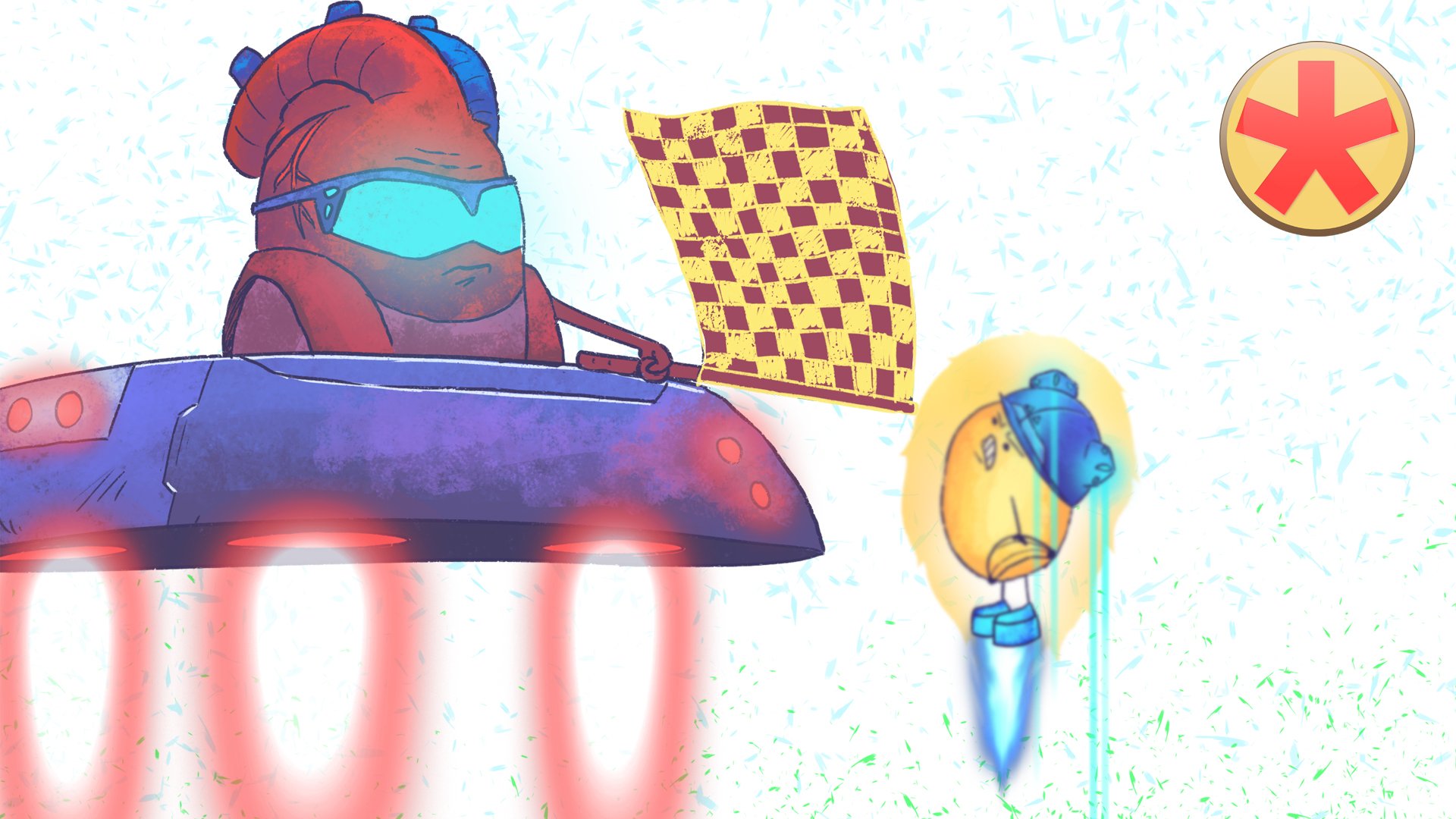
Aktionspotential des Arbeitsmyokards
Basiswissen
-
Grundlagen
Aktionspotential im Arbeitsmyokard des Herzens
Ionenschüler legen Potential-Prüfung des Herzens ab
Das Aktionspotential (AP) im Kardiomyozyten hat zwei Funktionen: 1. die Signalfunktion und 2. Auslösung der Kontraktion der Herz-Muskelzellen. Werden diese einzelnen Erregungen richtig koordiniert, entsteht aus der Kontraktion vieler einzelner Muskelzellen ein Herzschlag, der den restlichen Körper mit Blut versorgt.
-
Grundlagen
Ruhemembranpotential (RMP): ungleiche Ionenverteilung
Ruhend: ungleich verteilte Ionen (auf unterer & oberer Laufbahn)
Die intra- und extrazellulär unterschiedliche Ionenverteilung am Herzmuskel ist eine nötige Voraussetzung für RMP und AP. Intrazellulär ist die Konzentration von Kalium ↑, die von freiem Calcium & Natrium ↓. Extrazellulär ist es genau umgekehrt. Die Zellmembran reguliert mit Ionenpumpen & -kanälen, wie und wann die Ionen den Raum wechseln.
-
Grundlagen
RMP: Kalium-Ausstrom
Ausgeruht: Bananen-Katzen-Ion – steigt anfangs aus Kanal aus
Die Kardiomyozyten haben ein stabiles RMP von ca. –90 mV, weil Kir-Kanäle in Ruhe einen stetigen Kaliumausstrom zulassen (“leak”). Stabil bedeutet, dass sich ohne äußere Einflüsse nichts an diesem Potential ändert (Schrittmacherzellen: kein stabiles RMP). Das RMP stellt sich daher beim Gleichgewichtspotential von Kalium ein (ebenfalls –90 mV).
-
Grundlagen
Kir-Kanal (aus 4 Untereinheiten)
Kirch-Ionenkanal (auf 4 Säulen)
Der Kir-Kanal sitzt in der Zellmembran und erlaubt einen stetigen Fluss von Kalium-Ionen aus der Zelle (Kir = Kalium inward rectifier, also Kalium-Einwärtsgleichrichter). Der Strom durch diesen Kanal wird als IK1 bezeichnet. Er bedingt das stabile RMP. 4 Untereinheiten – ringförmig angeordnet – bilden bei diesem K+-Kanal die Kanalpore.
-
Ablauf des Aktionspotentials
Initiale Depolarisation der Myozyten
Herz gibt Startschuss
Um den “Startschuss” zum Beginn des Aktionspotentials zu geben, müssen bereits erregte Nachbarzellen (teilweise aus Zellen des Erregungsleitungssystems) den Myozyt depolarisieren, d.h. das Membranpotential muss positiver werden.
...
Expertenwissen
-
Ablauf des Aktionspotentials
Anwendung: Kardioplegie
Lahmes Herz liegt in Bananen-Flüssigkeit
Die absolute Refraktärzeit nutzt man, um das Herz für die OP stillzulegen. Dabei umgibt man es mit stark Kalium-haltiger Flüssigkeit (Kardioplegie-Lösung). Die Kardiomyozyten werden so dauerhaft depolarisiert und die Natriumkanäle können sich nicht von der Inaktivierung erholen → elektr. Stillstand ohne Kontraktion & ↓ O2-Verbrauch.
-
Ablauf des Aktionspotentials
Anwendung: Kardioversion
Ziel der Prüfung: umgedrehtes Herz
Manche Rhythmusstörungen erfordern eine elektrische Kardioversion (≈ Defibrillation d. schlagenden Herzens). Höchst wichtig ist, dass der Elektroschock nicht in die vulnerable Phase des Herzschlages fallen darf (Gefahr: Kammerflimmern). Moderne Geräte synchronisieren sich daher mit dem EKG-Rhythmus und wählen einen passenden Schock-Zeitpunkt.
-
Ablauf des Aktionspotentials
Vulnerable Phase
Verwundetes Bananen-Ion
In der 2. Hälfte der Repolarisation erholen sich die ersten Natriumkanäle von der Inaktivierung. Trifft in dieser relativen Refraktärzeit ein Reiz von außen/einem ektopen Kammerschrittmacher eine Herzmuskelzelle, sind kreisende Erregungen zw. erregtem & unerregtem Myokard mit anhaltenden Tachykardien bis Kammerflimmern möglich.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Anbei findet ihr das Erkundungsbild speziell für das Ruhemembranpotential:
(Info: Hier findet ihr keine klickbaren Faktenpunkte, da das Bild nur einen anderen Zustand zeigen soll.)
Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
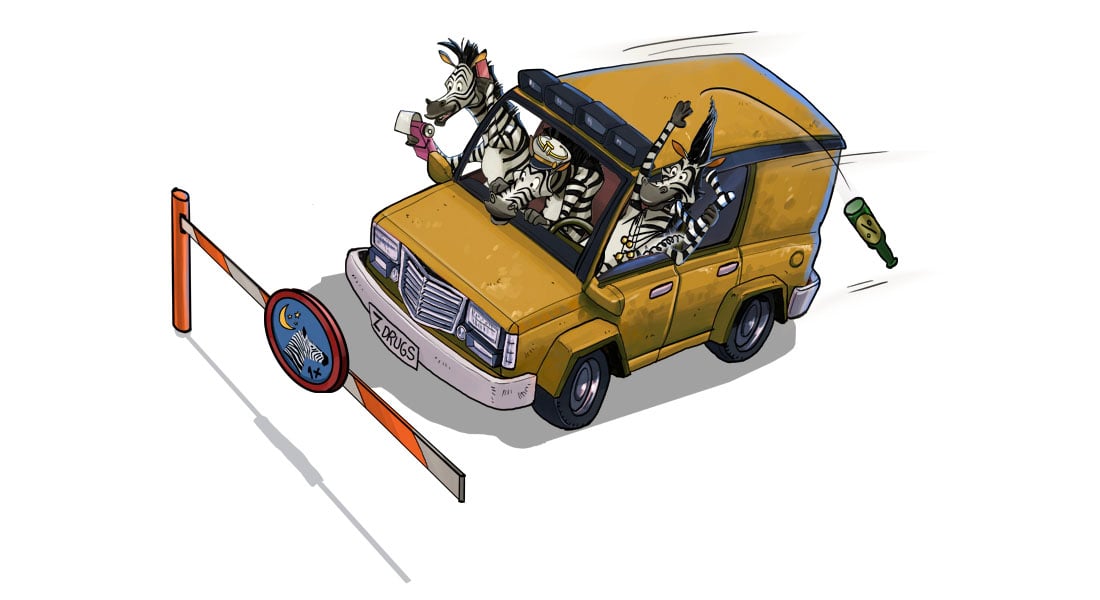
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:
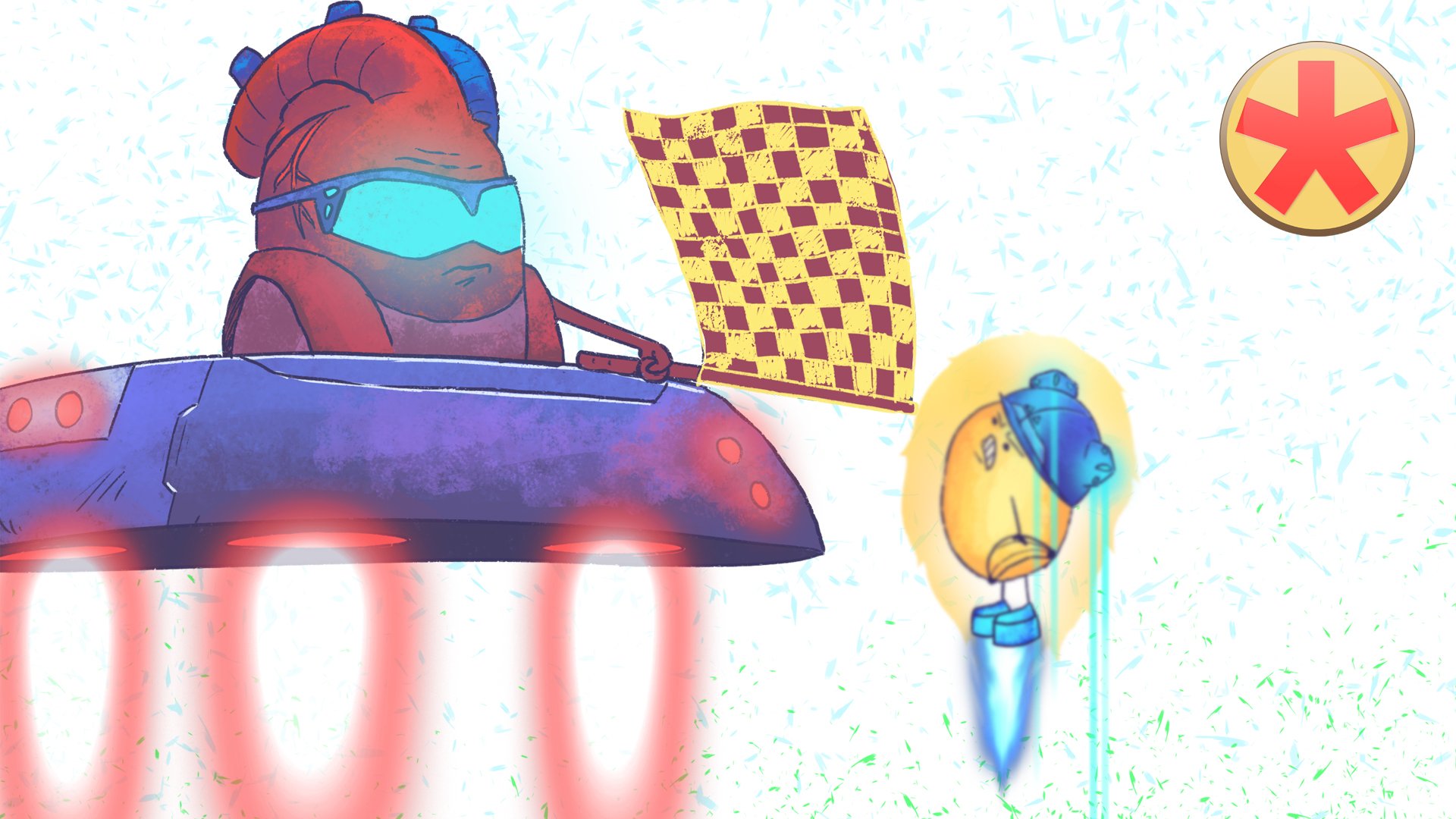
Aktionspotential des Arbeitsmyokards
Basiswissen
-
Grundlagen
Aktionspotential im Arbeitsmyokard des Herzens
Ionenschüler legen Potential-Prüfung des Herzens ab
Das Aktionspotential (AP) im Kardiomyozyten hat zwei Funktionen: 1. die Signalfunktion und 2. Auslösung der Kontraktion der Herz-Muskelzellen. Werden diese einzelnen Erregungen richtig koordiniert, entsteht aus der Kontraktion vieler einzelner Muskelzellen ein Herzschlag, der den restlichen Körper mit Blut versorgt.
-
Grundlagen
Ruhemembranpotential (RMP): ungleiche Ionenverteilung
Ruhend: ungleich verteilte Ionen (auf unterer & oberer Laufbahn)
Die intra- und extrazellulär unterschiedliche Ionenverteilung am Herzmuskel ist eine nötige Voraussetzung für RMP und AP. Intrazellulär ist die Konzentration von Kalium ↑, die von freiem Calcium & Natrium ↓. Extrazellulär ist es genau umgekehrt. Die Zellmembran reguliert mit Ionenpumpen & -kanälen, wie und wann die Ionen den Raum wechseln.
-
Grundlagen
RMP: Kalium-Ausstrom
Ausgeruht: Bananen-Katzen-Ion – steigt anfangs aus Kanal aus
Die Kardiomyozyten haben ein stabiles RMP von ca. –90 mV, weil Kir-Kanäle in Ruhe einen stetigen Kaliumausstrom zulassen (“leak”). Stabil bedeutet, dass sich ohne äußere Einflüsse nichts an diesem Potential ändert (Schrittmacherzellen: kein stabiles RMP). Das RMP stellt sich daher beim Gleichgewichtspotential von Kalium ein (ebenfalls –90 mV).
-
Grundlagen
Kir-Kanal (aus 4 Untereinheiten)
Kirch-Ionenkanal (auf 4 Säulen)
Der Kir-Kanal sitzt in der Zellmembran und erlaubt einen stetigen Fluss von Kalium-Ionen aus der Zelle (Kir = Kalium inward rectifier, also Kalium-Einwärtsgleichrichter). Der Strom durch diesen Kanal wird als IK1 bezeichnet. Er bedingt das stabile RMP. 4 Untereinheiten – ringförmig angeordnet – bilden bei diesem K+-Kanal die Kanalpore.
-
Ablauf des Aktionspotentials
Initiale Depolarisation der Myozyten
Herz gibt Startschuss
Um den “Startschuss” zum Beginn des Aktionspotentials zu geben, müssen bereits erregte Nachbarzellen (teilweise aus Zellen des Erregungsleitungssystems) den Myozyt depolarisieren, d.h. das Membranpotential muss positiver werden.
...
Expertenwissen
-
Ablauf des Aktionspotentials
Anwendung: Kardioplegie
Lahmes Herz liegt in Bananen-Flüssigkeit
Die absolute Refraktärzeit nutzt man, um das Herz für die OP stillzulegen. Dabei umgibt man es mit stark Kalium-haltiger Flüssigkeit (Kardioplegie-Lösung). Die Kardiomyozyten werden so dauerhaft depolarisiert und die Natriumkanäle können sich nicht von der Inaktivierung erholen → elektr. Stillstand ohne Kontraktion & ↓ O2-Verbrauch.
-
Ablauf des Aktionspotentials
Anwendung: Kardioversion
Ziel der Prüfung: umgedrehtes Herz
Manche Rhythmusstörungen erfordern eine elektrische Kardioversion (≈ Defibrillation d. schlagenden Herzens). Höchst wichtig ist, dass der Elektroschock nicht in die vulnerable Phase des Herzschlages fallen darf (Gefahr: Kammerflimmern). Moderne Geräte synchronisieren sich daher mit dem EKG-Rhythmus und wählen einen passenden Schock-Zeitpunkt.
-
Ablauf des Aktionspotentials
Vulnerable Phase
Verwundetes Bananen-Ion
In der 2. Hälfte der Repolarisation erholen sich die ersten Natriumkanäle von der Inaktivierung. Trifft in dieser relativen Refraktärzeit ein Reiz von außen/einem ektopen Kammerschrittmacher eine Herzmuskelzelle, sind kreisende Erregungen zw. erregtem & unerregtem Myokard mit anhaltenden Tachykardien bis Kammerflimmern möglich.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Menü Physiologie
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.